Bei den Gags „Hirnaussaugen, Kettensägenbenzin und dem Hamster in der Mikrowelle“ kommt meine Erinnerung noch nach über dreißig Jahren mit viel Anschauungsmaterial zu einem der kultigsten Spiele der Achtziger einher. Was Lucasfilm anno 1987 für den C64 rausbrachte, war ein Meilenstein, der Computerspielen etliche neue Elemente bescherte. Maniac Mansion war in vielerlei Hinsicht anders. Absurd, schräg und gleichzeitig fordernd und urkomisch. Und schaffte es, meine jugendliche Fixierung auf Actionspiele so langsam aber sicher zu lösen. Und nun, eine Ewigkeit später, ist die Luft aus dem alten Software-Schinken sicherlich raus. Oder nicht?

Maniac Mansion (Lucasfilm Games, 1987)
Wenn ich an den C64 als meinen ersten Heimcomputer zurückdenke, den ich 1987 nach langer Bettelei bekam, waren da an Spielen in der großen 5,25-Zoll-Diskettenbox überwiegend solche, die Reaktion und Geschicklichkeit erforderten. Baller- und Hüpfspiele, um es plump auszudrücken. Genau dafür war mein „Brotkasten“ mit dem unverwüstlichen Steuerknüppel „Competition Pro“ bestens ausgestattet. Wo ein „Quickjoy“ nach einer Stunde „R-Type“ oder „Summer Games“ in alle Einzelteile zerlegt war, hielt so ein „Competition Pro“ auch mal einen Frustwurf gegen die Wand aus. Dass Spiele auch mehr als Rüttel- und Klickorgien können, dämmerte mir Anfang 1988, als auf dem Schulhof die magischen Worte „Maniac Mansion“ die Runde machten.
Mit Adventures hatte ich bis dahin wenig am Hut. Meist haperte es an der Geduld, die passenden Befehle zu finden, die der jeweilige Textparser verstand. Und lange Texte zu lesen war damals auch noch nicht so mein Ding. Roch zu sehr nach schwafelnden Deutschlehrern und der verstaubten Schulbank. Auf der konnte man die wirklich interessanten Dinge auch nicht lernen. Für unsere Lehrer auf dem Gymnasium waren Heimcomputer der Untergang des Abendlandes, unnützer Technikkram, und Spiele-Software ein Modetrend oder eine Krankheit, die bald wieder verschwunden ist. Und wären sie inzwischen nicht alle verstorben, würden sie heute mit dem Füllfederhalter der E-Mail trotzen. Sei es drum, wir Pennäler hatten ja nachmittags den C64 als willkommene Abwechslung. Und so pendelten wir nach Unterrichtsschluss immer zu dem hin, der gerade ein paar neue Games am Start hatte.
Und dann war da dieses Spiel, von dem jeder sprach. Das enorm cool und lustig sei und wo man oft steckenbleibt – weil man mal wieder einen Fehler gemacht hat, der kaum vorhersehbar war. „Maniac Mansion“ verbreitete sich wie ein Computervirus. Und für einige Wochen gab es nur ein Gesprächsthema auf dem Schulhof: Wer kommt wie weit und findet von allein die absurden Lösungen zu den Rätseln im Spiel. Bis der erste Dussel die Komplettlösung in der ASM-Special fand und sich verplappern musste. Da war es dann durchgezockt. Doch es blieben zum Tratschen ja noch die Gags und die schräge Story, die das Spiel ebenso zu einem Unikat machten.
- Startbildschirm mit Charakterwahl (MS-DOS)
- „Hat jemand die Hosen voll?“
- Überraschung: Der Schlüssel liegt unter der Hausmatte
- Und drin im Irrenhaus!
Maniac Mansion – worum ging’s nochmal?
Die Geschichte hinter „Maniac Mansion“ liest sich wie Sci-Fi-Schund der Fünfziger. Ein Meteor kracht vor 20 Jahren nahe dem Anwesen der Familie Edison ein und verwandelt durch freigesetzte Strahlung die Sippschaft in verdrehte Sonderlinge. Aus dem pensionierten Hausarzt Dr. Fred wird ein verrückter Wissenschaftler, der sich in den Keller verzieht, dort einen Atomreaktor installiert („Made in Chernobyl“) und zusammen mit seinem Lakai, dem purpurnen Saugnapf-Tentakel, an seltsamen Dingen herumexperimentiert.
In den oberen Etagen residieren Frau Edna, ehemalige Krankenschwester und nun Hobby-Betreiberin einer … ähem … Telefonhotline. Im Nebenzimmer wohnt Sohn Ed („Weird Ed“) mit seinem Lieblingshamster und direkt darüber im Dachgeschoss ein grünes, sprechendes Tentakel, das gerne eine Rockband gründen würde. Und dann gibt es noch den toten Cousin Ted, der als in Klopapier eingewickelte Mumie in der Dusche abgelegt und vergessen wurde.
Dr. Fred’s Traum ist die Kontrolle der Menschheit. Diesen Floh hat ihn natürlich der Meteor ins Ohr gesetzt. Auch, dass er für seine Experimente unbedingt ein paar menschliche Hirne braucht. Und so entführt er ausgerechnet Sandy Pantz, eine Cheerleader-Trulla des nahegelegenen College, um ihr das strohblonde Hirn abzusaugen. Ihr Freund Dave Miller will dies natürlich verhindern. Und startet mit zwei Kommilitonen eine Rettungsaktion – nachts, vor dem Anwesen der Edisons. Und hier beginnt das Spiel.
- In der Küche von Edna erwischt!
- Sandys Hirn soll abgesaugt werden …
- Eigener Atomreaktor im Keller
- „Du kommst hier nicht durch!“
„Point-and-Click“ statt Befehle eintippen
Hat man sich zum Hauptcharakter Dave zwei Begleiter ausgesucht, gilt es, das Haus erst einmal irgendwie zu betreten. Das ist noch relativ simpel, da der Türschlüssel erwartungsgemäß unter der Hausmatte liegt. Per Fadenkreuz (das man mit dem Joystick steuert) bewegt man seine Spielfigur durch die einzelnen Bildschirme, klickt sich passende Befehle zusammen und lässt so seine Figur agieren. Im Vergleich zu den Textadventures jener Zeit war das ein Quantensprung in Sachen Bedienbarkeit, der einen Zeit und Tipperei ersparte.
Bis auf „What is“, was man leicht als Befehl zum Untersuchen des Inventars missverstehen könnte, sind alle Befehle intuitiv verständlich. Mit „What is“ tastet man aber den jeweiligen Raum ab und erhält die Namen der Objekte, über denen sich das Fadenkreuz gerade befindet. Also eigentlich etwas, das standardmäßig aktiviert sein sollte. Wie wichtig dieser Befehl ist, wird klar, wenn stockdunkle Räume betreten werden und man den Lichtschalter sucht – ansonsten klickt man sich blind einen Wolf.
Die Spielwelt nimmt ca. 60% des Bildschirms ein, darunter befindet sich fest verdrahtet das Interface samt Inventar und oberhalb gibt es noch zwei Zeilen Freiraum für Dialoge. Dinge, die man heute selbstverständlich in die Spielwelt integrieren würde, z. B. durch kontextsensitive Menüs. Aber dafür war damals noch nicht die Zeit. Und bei nur zwei Programmierern (Chris Grigg und David Lawrence) wahrscheinlich auch nicht die nötige Kapazität vorhanden.
Neben dem komfortablen Klick-Interface führte man ins Adventure auch einen echtzeitlichen Ablauf mit ein. Nach gewissen Zeitintervallen werden immer wieder Ereignisse ausgelöst. So hat Sohn Ed plötzlich Hunger und geht in die Küche, dann klingelt der Postbote und legt ein Paket ab – oder Dr. Fred schaltet für ein paar Minuten den Strom aus, sofern er nicht gerade am „Meteor-Mess“-Automaten daddelt und durch seine Highscore die Zahlenkombination für die Labortür neu setzt. Bei solchen Skriptsequenzen muss man innerhalb eines Zeitintervalls schnell reagieren, sonst ist z. B. das Paket weg oder Ed erwischt einen in der Küche. Zusammen mit den regelmäßigen Zwischensequenzen glich das schon einem interaktiven Film.
- Treppe außer Betrieb?
- Raketenbetriebener „Edsel“ in der Garage
- Fitnessmaschine neben Sarkophag. Sport ist Mord?
- „Wenn die Sehnsucht quält, man Ednas Nummer wählt.“
Maniac Mansion – nach Ewigkeiten neu durchgespielt
Die Idee, wieder einmal in die schräge Welt von „Maniac Mansion“ abzutauchen, hatte ich schon länger. Und nun war es soweit. Da der C64 schon lange verkauft war, blieb immerhin die MS-DOS-Version, die ich mir Jahre später zulegte und noch gut erhalten ist. Spielerisch ist sie identisch zur C64-Variante, grafisch durch den EGA-Standard ein wenig detaillierter (was nach heutigen Maßstäben aber kaum auffällt). Aus irgendwelchen Gründen färbte man in allen späteren Versionen die Familie Edison türkis ein. Vielleicht, um das Verstrahlte zu unterstreichen? Wäre aber nicht nötig gewesen.
Der Einstieg ins Spiel war wie ein Heimkommen nach langer Zeit. Und das erste Grinsen entwich, als sich das Fadenkreuz beim Laden in ein Schnecken-Icon verwandelte. Der Humor von Ron Gilbert und Gary Winnick. Und so sollte es weitergehen. In der Küche fragte ich mich, was eine Kettensäge neben dem Filetiermesser zu suchen hat. Glücklicherweise fehlte das Benzin für irgendwelche Schandtaten. Dafür ließ sich mit der Mikrowelle noch immer allerlei Unsinn anstellen, wie z. B. Eds Hamster zum Platzen zu bringen.
Aber das Spiel besteht ja nicht nur aus dem Missbrauch von Küchengeräten. Primäres Spielprinzip ist und bleibt das Lösen von Rätseln, sprich wie kombiniere ich Objekte, um im Spiel voranzukommen. Durch Logik lässt sich vieles lösen, auch wenn die Lösungen nicht immer offensichtlich sind. So bringt z. B. eine Schallplatte mit hochfrequenter Aufnahme im Musikzimmer die Vase zum Zerspringen. Im Glaskronleuchter des Wohnzimmers hängt unerreichbar ein Schlüssel. Aha! Also überspielt man die Platte auf Tape, das dann mit dem Tonbandspieler im Wohnzimmer abgespielt wird. Gleicher Effekt und der Schlüssel liegt am Boden. Oder nach Benutzung der Fitnessmaschine hat Dave mehr Muskelkraft und kann nun das schwere Garagentor stemmen. Alles sehr schräg, aber durchaus logisch.
- Grünes Tentakel würde gern eine Band gründen
- Der Hamster ist heilig!
- „Der hockt seit fünf Jahren im Keller!“
- Ed mag keinen Klingelstreich
Da dämmerte es mir, dass genau dieses Spielprinzip einige Jahre später mit „Resident Evil“ (PlayStation, 1996) wiederbelebt wurde. Ein unbekanntes Anwesen wird betreten, jeder Raum ist Neuland und wird nach Objekten durchsucht, die irgendwo anders zum Weiterkommen benötigt werden. Dazu die Beklemmung, ständig von irgendwem oder irgendwas erwischt zu werden. Der eklatante Unterschied zu „Maniac Mansion“ (bis auf Waffeneinsatz als sekundäres Spielprinzip) ist, dass bei „Resident Evil“ wirklich alle Rätsel strikt auf dem gesunden Menschenverstand basieren und teilweise schon so lächerlich offensichtlich sind, dass man sie auch hätte weglassen können.
Ganz anders bei „Maniac Mansion“. Hier sind einige Lösungen so absurd, dass Versuch und Irrtum oft als einzige Mittel bleiben. Wie soll man auch darauf kommen, dass die fleischfressende Pflanze, die den Zugang zur Dachluke behindert, zuerst mit Pepsi betäubt werden muss, um sie danach mit radioaktiver Flüssigkeit aus dem Swimmingpool zum Wachsen zu bringen? Gut, wer einmal Pepsi getrunken hat, könnte vielleicht von alleine darauf kommen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele gefundene Objekte überhaupt keinen Nutzen im Spiel haben und nur das Inventar vollmüllen.
Als Trostpflaster zu den (fast) unlösbaren Rätseln findet man im Spiel überall diesen besonderen Humor. Hat man z. B. mit Bernard das Telefon in der Bibliothek repariert, fehlt nur noch eine Nummer zum Wählen. Die bekommt man, wenn mit der gefundenen Duscharmatur die Dusche wieder zum Laufen gebracht wird und der Wasserstrahl den toten Ted beiseite schiebt. So wird Ednas an die Duschwand gekritzelte Hotline-Nummer lesbar. Also ran an den Speck. Und da die schüchterne Spaßbremse Bernard keinen Ton herausbekommt, erklärt Edna erst einmal, wie man lasziv in den Hörer haucht.
Mit Bernard im Rettungstrupp hat man auch die unkomplizierteste Lösungsvariante (von insgesamt fünf). Hat der Nerd auch das Funkgerät im Schlafzimmer repariert und das intergalaktische Fahndungsplakat gelesen, funken wir als Problemlöser nicht „Mr. Wolf“, sondern die Meteorpolizei an. Und so dauert es nicht lange, bis ein grüner, grimmiger Meteor-Cop erscheint, das purpurne Tentakel anblafft („Don’t bug me, sucker-face!“) und den Meteor im Freds Geheimlabor einfach mitnimmt. Jetzt braucht man nur noch Freds Höllenmaschine abzuschalten und Sandy darf ihr Hirn behalten. Und flux ist das Spiel beendet, das einen lapidar zum Durchspielen beglückwünscht.
- Die Kavallerie ist in fünf Minuten da.
- Aus dem Weg, Saugnapf!
- Der Pepsi-Automat im Labor
- Ende gut, alles gut?
Fazit – trotz biblischen Alters noch immer ein Spaß!
Natürlich ist bei „Maniac Mansion“, einem Game der Heimcomputer-Kreidezeit, nicht alles perfekt gealtert. Sich umständlich aus Verben die richtigen Befehle zurechtzuklicken ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Was anno Tobak bahnbrechend war, schreckt heute um so mehr ab. Gerade für jüngere Spieler, die das Original nie erfahren haben, wird das wahrscheinlich mit das größte Hemmnis darstellen.
Gleiches gilt für die damalige Optik mit gerade mal 16 Farben und einer Auflösung von 320×200 (C64) bzw. 640×350 (DOS) Pixeln. Und es ist ein nahezu unmögliches Unterfangen, den Gamern von heute zu erklären, dass ein „Maniac Mansion“ weder 3D-Welt noch fotorealistische Darstellung braucht. Wie soll man den verwöhnten Spielern auch nahebringen, dass zu viel Realismus Gift für die Fantasie ist? Wo moderne Spiele einen optisch alles vorkauen und suggeriert wird, dass nur mit der neuesten Grafikkarte die beste Spielerfahrung möglich ist.
Bedienung und Optik hin oder her, die wahre Stärke von „Maniac Mansion“ teilt noch heute aus wie die Rechte von Muhammad Ali. Dieser Humor und diese Schrägheit haben mich nach dreißig Jahren wieder sowas von umgehauen. Und ich kenne nur eine Handvoll Spiele, die es damit aufnehmen könnten. So bleibt die Erkenntnis, dass dieses Spiel zu Recht zu den ganz großen Klassikern der Spielegeschichte zählt. Und man von Pepsi lieber die Finger lassen sollte.






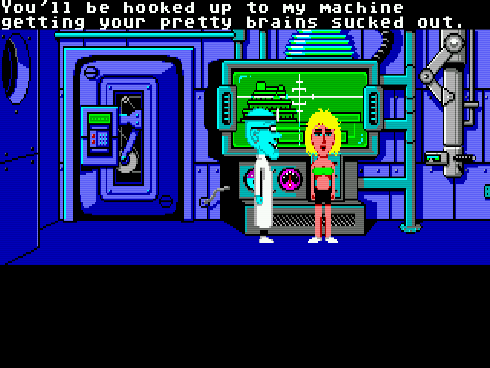
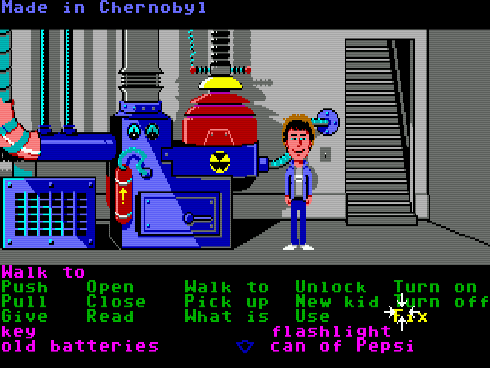


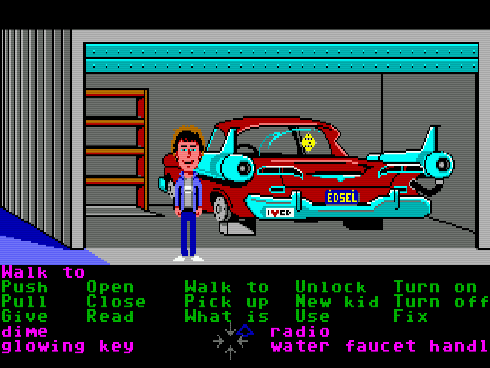
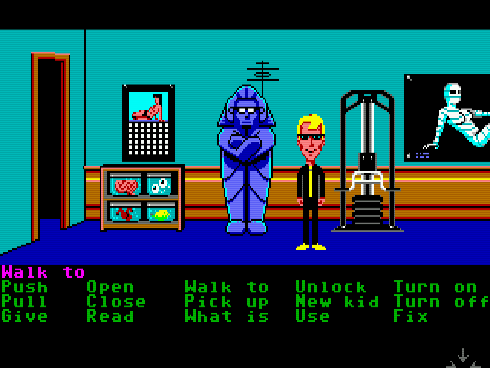
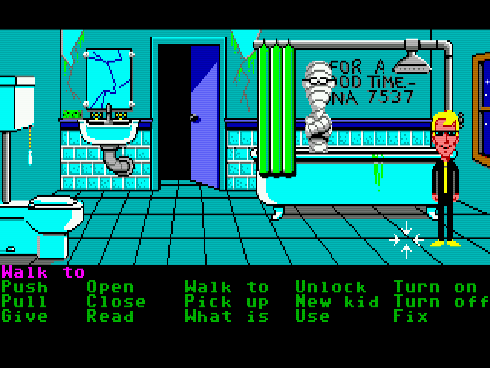
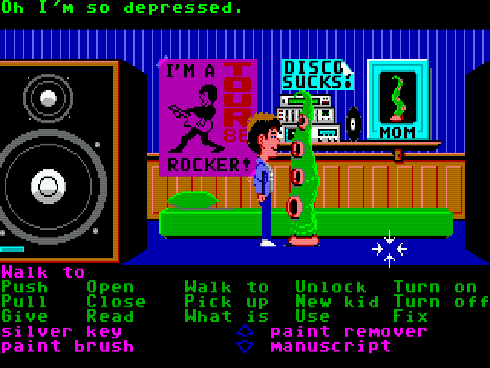















Schreibe einen Kommentar