Wenn es neben Comics, BMX und Computerspielen etwas gab, das meine Kindheit und Jugend wie nichts anderes prägte, dann war es die Zeit im Kleingarten. So ein autonomer Garten hat in unserer Ahnentafel Tradition. Nicht nur die Urgroßeltern hatten einen, auch die Großeltern beackerten fast ihr gesamtes Leben ihr eigenes „Lande“. Wo dann später auch meine ersten Lebensjahre begannen. Und um 1982 entschlossen sich die Eltern, sich ebenfalls eine Parzelle zuzulegen. Die von uns über zehn Jahre als Hobby- und Erholungsort genutzt wurde. Solche auch als Schrebergärten bezeichneten Orte sind als Raststätte auf der Strecke des Alltags nicht zu unterschätzen. Und wer vorhat, sein eigenes Grundstück im Grünen zu bewirtschaften, kann sich glücklich schätzen. Damals wie heute. Besonders wenn man nur das Stadtleben kennt, vielleicht noch in einer dieser Betonsiedlungen wohnt. Denn Kleingärten dienen nicht nur zur Selbstverwirklichung und dem Anbau von Obst und Gemüse, sie haben auch viele versteckte Werte, die einen erst im fortgeschrittenen Alter richtig bewusst werden.

Der Kleingartenverein „Gute Ernte“ e. V. in Bremen Horn-Lehe. Eine natürliche Oase inmitten einer Stadt.
Wenn ich heute an die Zeit auf der Parzelle zurückdenke, kommt mir das wie ein halbes Leben vor. Als hätte ich nirgendwo anders Kindheit und Jugend verbracht. Dabei waren es nur knapp über zehn Jahre. Zehn Jahre, die in späteren Jahren wie im Flug verstreichen, damals einen fast endlos erschienen. So kamen und gingen die Jahreszeiten an einem Ort, wo ich an einem Tag mehr lernen konnte als in einem Halbjahr der Grundschule. Wo Naturgeräusche den Stadtlärm verdrängten und der Alltag meilenweit entfernt schien. Dass solche Kleingärten in Deutschland erst seit ungefähr 150 Jahren existieren, war mir damals kaum bewusst. In Bremen mit seiner recht hohen Kleingartendichte findet man in fast jedem Stadtteil so eine Kleingartensiedlung. Als wären sie schon immer da gewesen. Dabei entstand die Idee erst in der Zeit des Deutschen Kaiserreichs.
So geht der Begriff „Schrebergarten“ auf den Arzt Moritz Schreber (1808-1861) zurück, der im 19. Jahrhundert kindgerechte Spiel- und Turnplätze förderte, um so die Gesundheit der Kinder zu verbessern. Hintergrund waren die typischen Begleiterscheinungen der Industrialisierung, wie beengte Wohnverhältnisse, Lichtmangel, Armut und Mangelernährung. Mit Gärtnern hatte er aber wenig am Hut. Und das Synonym „Schrebergarten“ entstand auch erst nach seinem Tod. Denn der Pädagoge Karl Gesell (1800-1879) griff Schrebers Idee auf und legte die ersten Kleingartenanlagen an, wo Kinder durch Gartenarbeit gesundheitlich wieder in Form kommen sollten. Die hatten aber recht schnell keine Lust mehr auf Unkraut jäten, so dass die Beete langsam verwilderten. Das Ergebnis war, dass die Eltern fortan die Pflege der Gärten übernahmen. Und die Vorstellung eines eigenen Kleingartens für die Familie wurde populär.
1982: „Wir kaufen uns ’ne Parzelle!“
Kurz vor meiner Einschulung erfuhr ich, dass eine Parzelle gekauft wurde. Das war großartig! Also ab ins Auto Richtung Horn-Lehe und rein ins Kleingartengebiet „Gute Ernte e. V.“ zur ersten Begutachtung. Vorbei an vielen gepflegten Gärten mit Sandkiste und Klettergerüst. Ich schaute fasziniert aus dem Fenster. Und dann machte unser Auto ausgerechnet an einem dieser Orte halt, die man nachts aufsucht, wenn etwas illegal entsorgt werden muss. Was war das denn? Alles verwildert, kaputt und mit Gelumpe vollgestellt. Von Sandkiste oder Klettergerüst keine Spur. Die eine Hälfte des Zauns hing schief, die andere fehlte komplett. Ein maroder Betonweg führte zum Gartenhaus, das sich als muffige Bretterbude entpuppte. Hier schien seit dem Krieg alles verloren zu sein. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass an so einem Ort irgendwann mal wieder echtes Leben einkehrt. Und staunte nicht schlecht, als zwischen den brüchigen Betonresten eine ganze Froschfamilie zum Vorschein kam.
Die Alten hatten sich also eine Müllkippe mit Urwald gekauft. Taten aber so, als hätten sie das Taj Mahal erworben. Mich konnte die Begeisterung nicht anstecken, auch wenn man mir enthusiastisch erklärte, hier was Tolles draus machen zu können. So wurde in den nächsten Wochen geplant und gezeigt, erklärt und vermessen. Und wenn sie nicht gerade in Bremens Baumärkten Preise verglichen, wurde ich gespannt nach meiner Meinung gefragt. Dabei wollte ich doch nur ein Klettergerüst. Wenig später legte der rekrutierte Bautrupp aus Verwandtschaft und Arbeitskollegen los. Und es gab viel zu tun. Nicht nur der ganze Unrat musste entsorgt werden, auch der Urwald wurde abgeholzt. Die größte Plackerei blieb aber die Entsorgung des alten Betons. Wer hatte sich hier nur mit dem Betonmischer ausgetobt? Und auch noch seinen eigenen „Erdbunker“ angelegt, der neben der Bretterbude durch ein fenstergroßes Loch in die Tiefe führte. Das Loch wurde erstmal mit dicken Steinplatten pragmatisch versiegelt.
Die Monate vergingen und die Arbeit schien endlos. Doch im Laufe nur eines Jahres veredelte sich die Mondlandschaft zu einer ansehnlichen Parzelle mit Gartenhaus, die 1983 dann erstmals zur Erholung und nicht mehr der Maloche wegen aufgesucht wurde. Wo dann auch mein eigenes Klettergerüst „Kettler-Trimmstation“ stand. Mit zwei Schaukeln, Klimmzugstange und Kletterseil. Da hatte ich nun endlich meinen eigenen Spielplatz. Und wenn man es genau nimmt, einen ziemlich großen sogar. Denn neben unserer Pappel war ein massiver Sandhaufen, der von mir zur Burg umgebaut wurde. Und direkt vor unserem Garten lag ja noch die große Weide, wo der Bauer seine Rinder in der hellen Jahreszeit parkte. Und es keine zwei Minuten dauerte, bis ich nach Erspähung einiger Kühe über Graben und Stacheldraht sprang und in Richtung Kuhherde marschierte. Ein lauter Pfiff mich aber zur Umkehr zwang.
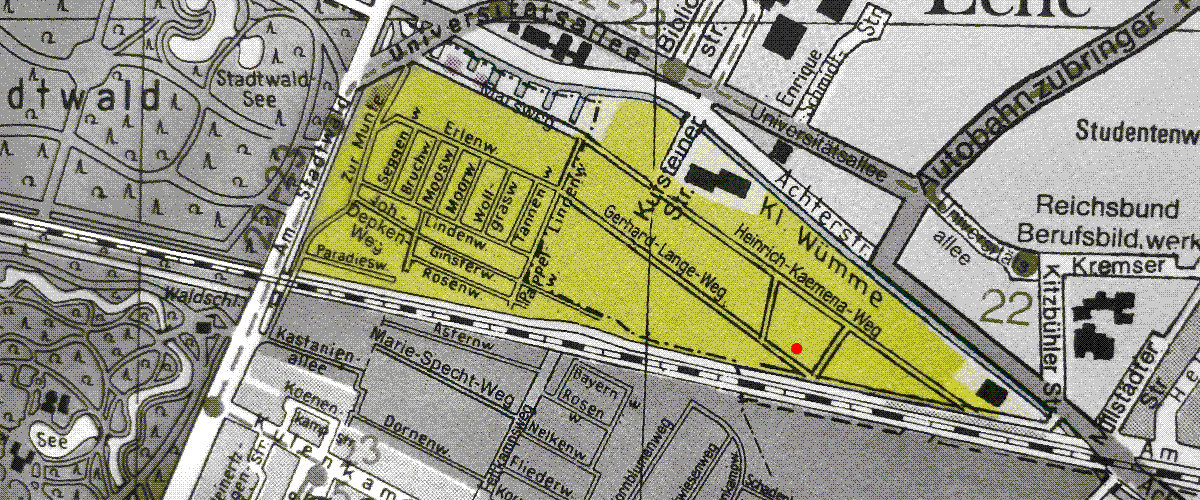
Der Bremer Kleingartenverein „Gute Ernte“ e. V. in Bremen Horn-Lehe, der von 1938 bis 1998 in voller Größe existierte und dann Infolge der Technologieparkerweiterung überwiegend dem Erdboden gleichgemacht wurde. Im Prinzip bestand der Kleingartenverein aus dem „Gerhard -Lange-Weg“ sowie dem „Heinrich-Kaemena-Weg“. Die Parzellen westlich davon gehören zum Kleingartenverein „Harmonie“, der noch immer existiert. Von der „Guten Ernte“ sind heute nur noch wenige Parzellen im Ginster-, Rosen-, und Pappelweg übriggeblieben. Der rote Punkt markiert die Position unserer Parzelle, die von 1982 bis 1994 bewirtschaftet wurde, direkt an der ehemaligen Weide von Bauer Kaemena.
Die goldenen Jahre im Kleingarten
Das war also unser neues Idyll im „Gerhard-Lange-Weg“, das in den kommenden Jahren stets eine ausgewogene Mischung aus Arbeit und Erholung bot. Zumindest für die Eltern. Ich wählte statt „Arbeit“ lieber „Entdeckung“ und erkundete die Umwelt. Verdrückte mich stets, wenn Frondienst in der Luft lag. Sträucher schneiden, Erdbeeren pflücken oder Unrat zur Mistkuhle karren? Langweilig. Wenn, dann habe ich die Schubkarre lieber als Chefsessel zweckentfremdet und Löcher in die Luft gestarrt. Beobachten, ohne teilzunehmen. Denn zu entdecken gab es reichlich. Auch am Boden. Zu jener Zeit waren die Gräben noch voller Frösche, Blutegel, Molche und Bisamratten. Irgendwas fischte ich mit dem Kescher da immer heraus. Und wenn ich nicht gerade Lurche fing, saß ich auf dem Kinderrad und zog von Horn-Lehe über Schwachausen, von der Vahr bis hoch nach Oberneuland meine weiten Kreise.
Mitte der Achtziger machte hierzulande der BMX-Trend halt, der auch mich begeisterte. Natürlich wollte ich so einen Hobel haben, keine Frage. Man war aber wenig gewillt, diesem arbeitsscheuen Banausen, der sich an keinerlei Verkehrsregeln hält, auch noch eines von diesen anrüchigen Geländefahrrädern ohne Straßenzulassung zu schenken. Man schenkt ja auch keinem Epileptiker ein Rasiermesser. Resultat war, dass ich an meinem blauen Kinderfahrrad bis auf Räder und Rahmen so gut wie alles abmontierte. Auch die Bremsen. Und mit dieser blanken Scheese wie ein Wilder durchs Gelände heizte. So stand also Weihnachten 1985 notgedrungen doch noch ein echtes BMX vorm Baum. Was spätestens dann wieder bereut wurde, als ich entdeckte, dass sich mit den dicken Reifen auch kunstvoll meterlange Bremsspuren in den Schotterweg vor unserer Parzelle „malen“ lassen.
Mit der Parzelle als zentralem Stützpunkt, nutze ich das Rad aber auch artgerecht, um stundenlang mit den BMX-Kumpels im alten Unigelände Rennen, Stunts und Weitsprünge zu üben. Dort, wo heute der Fallturm steht, war bis 1988 noch echte Wildlandschaft mit bis zu zehn Meter hohen Hügeln. Ein Paradies aus Offroad, Schanzen und Dreck. Ich weiß noch, wie wir trotzig die hölzernen Absteckpfähle der Bauarbeiter wieder herausgerissen haben – in der Hoffnung, so den Bau des Fallturms zu verhindern. Gebracht hat es nichts. Und ähnlich hart wie einige Bruchlandungen mit dem BMX war die Enttäuschung, als unser Gelände plötzlich futsch war. Da mussten Alternativen her. Eine war der farbenprächtige Rhododendronpark, der nebenbei auch einen ganz praktischen Nutzen für mich hatte. Nicht nur, dass man dort ein paar Runden heizen konnte (was natürlich streng verboten war), man „fand“ auch jedes Jahr die richtigen Blumen, wenn Muttertag anstand.
Zu jener Zeit hatte sich die Parzelle längst als fester Bestandteil unserer Existenz etabliert. Und es war Usus, dort auch am Wochenende zu übernachten. In einer Zeit, wo Handys Zukunftsmusik waren und das Telefon daheim an einem dicken Kabel hing. Ein ganzes Wochenende telefonisch nicht erreichbar? Heutzutage undenkbar. Mehr Erfindungen als fließend Wasser und Strom hatten wir nicht. Und mehr brauchten wir auch nicht. Dennoch hatte es einen bizarren Charakter, die stockdunklen Nächte so völlig allein und abgeschieden zu verbringen. Hinter uns war zwar noch unser Nachbar, der emigrierte „Pälzer“, der ab und zu dort auch übernachte. Aber ob der mit seiner rheinischen Gelassenheit im Ernstfall eine große Hilfe gewesen wäre? Und richtig verstehen konnte man den auch selten. Fragte mich oft, wo man so ein Kauderwelsch spricht. Hätte man mir damals erzählt, dass ich selber einmal ins ferne Rheinhessen auswandere, hätte ich das sicherlich als Fastnachtsscherz abgetan.
Trotz allem lehrte einen das Nachtleben den nötigen Respekt vor der Natur. Und jedem auffälligen Geräusch in der Stille wurde aufmerksam gelauscht. In den meisten Fällen handelte es sich um harmlosen Tierbesuch. Mal war es ein Igel, der spät am Abend noch seine Schale Wasser bekam. Oder ein paar putzige Mäuse, die aber entsprechend der weiblichen Natur weniger willkommen waren. Und die man immer dann in der Nähe wusste, wenn ein schriller Schrei in der Luft hing. Aber auch am Tage wurde unser Garten von der Tierwelt besucht. Die Entenfamilie bekam altes Brot und schaute im nächsten Jahr mit dem Nachwuchs wieder vorbei. Dicke Kröten durchquerten unser Land von einem Graben zum nächsten. Vögel bevölkerten die Obstbäume und Weinbergschnecken zogen fast so malerisch wie meine BMX-Bremse ihre Schleimspuren. Die Krönung war allerdings Bulle „Kalli“, der an einem heißen Sommertag einmal ausgebüxt war und treudoof vor unserer Parzelle im Graben stand.
- (1982) Der marode Betonweg verhieß nichts Gutes.
- (1982) Die kräftige Pappel markierte schon aus der Ferne unsere Parzelle.
- (1982) Der Zaun machte keinen einladenden Eindruck.
- (1982) Das Gartenhaus war mehr eine einfache Bretterbude.
- (1982) Unrat wohin man blickte.
- (1982) Und Wildwuchs ohne Ende.
Der große Höhepunkt eines jeden Kleingartenjahrs war sicherlich die Erntezeit, die fast das ganze Jahr über stattfand. Im Frühling gab es Erdbeeren, im Sommer waren die Kartoffeln und Tomaten reif. Dann das ganze Baumobst und im Spätsommer hatten wir sogar Weintrauben. Die dem nördlichen Klima entsprechend klein ausfielen. Zwischendrin wurden immer mal wieder Kräuter, Zwiebeln, Möhren oder auch Radieschen geerntet. Das war die gute Ernte, von der man was hatte. Und im Herbst hatte sich der Kürbis von der Mistkuhle aus über den halben Garten ausgebreitet. Kam nicht selten vor, dass mehrere dicke Medizinbälle dranhingen, die dann mit der Schubkarre eingefahren wurden. So gab es den ganzen Winter über selbstgebackenes Kürbisbrot, das jeden Bäcker vor Neid hätte erblassen lassen. Und wer einmal eine selbstgezüchtete Tomate in der Hand hielt, wird künftig das Gemüsefach im Supermarkt mit kaltem Grausen meiden.
Besonders beeindruckend ist für mich noch heute der polymorphe Charakter, den meine Eltern unserer Parzelle verliehen. Getreu dem Motto „Es gibt immer was zu tun“ war nach getaner Arbeit schon das nächste Projekt in Planung. Schon früh kam eine Veranda hinzu. Samt ausrangiertem Sofa, Tischen und transportablem Röhrenfernseher. So hatte sich die Wohnfläche quasi verdoppelt, und man konnte den Abend wie gewohnt vor der Glotze verbringen. Was aber immer mit Aufwand verbunden war. Denn keine fünfzig Meter entfernt lag die Eisenbahnstrecke Bremen-Hamburg, wo mehrmals pro Stunde Fern- und Güterzüge verkehrten. Da die Fernseher damals noch über Funk das Programm empfingen, war es immer eine hohe Kunst, die Antennen so auszurichten, bis das Bild endlich stabil war. Kurz darauf der nächste Zug vorbeidonnerte, die Kiste erneut flackerte oder das Bild gänzlich weg war. Das nahm man damals so hin.
Ende der Achtziger folgte dann gleich ein ganzer Küchenanbau, so dass die Nahrungszubereitung genauso praktisch vonstatten ging wie in der Wohnung. Und es ist kein großes Geheimnis, dass Essen an der frischen Luft gleich doppelt schmeckt. Und wenn schon die Nahrungsaufnahme veredelt wurde, sollte das auch für die Nahrungsausscheidung geschehen. Also kam direkt neben der Küche noch ein weiterer Anbau mit Toilette hinzu, wo man sich auch richtig waschen konnte. Der Gartenschlauch hatte als Dusche ausgedient. Genau wie der provisorische Blechschuppen mit einfachem Campingklo. Das wurde durch den brandneuen „Porta Potti“ ersetzt – mit Fäkalientank und Zugmechanismus. Hat zwar weiterhin wie im Pumakäfig gerochen, besonders wenn im Sommer die Sonne den Anbau erhitzte, war aber eine Revolution gegenüber dem alten als „Goldeimer“ betitelten Metallkübel, der einst bei den Großeltern auf deren Parzelle als Klosett diente. Und wo die halbe Verwandtschaft fröhlich reingeschissen hat.
Wo viel gewerkelt wurde, durfte natürlich auch viel gefeiert werden. Kam nicht selten vor, dass eine komplette Bierzeltgarnitur samt Zapfanlage ausgeliehen wurde, Arbeitskollegen und Verwandte erschienen und unsere Parzelle mal eben zum farbenprächtigen Festplatz umfunktioniert wurde – und spätestens nach Mitternacht der Erste im Suff mit beiden Füßen im Graben stand. Für die Eltern war die Parzelle weitaus mehr als ein Hobby, fast schon eine Lebensaufgabe. Eine Dauerbaustelle, die ähnlich wie bei den „Doozers“ (kleine Bauarbeiter bei den „Fraggles“) permanent erweitert oder umgebaut wurde. Und man sich sicher sein konnte, dass am nächsten Wochenende sich irgendetwas wieder verändert hatte. Ein natürlicher Prozess des Werdens und Wandels. Oder anders ausgedrückt: Im „Gerhard-Lange-Weg“ war bis auf dem stehenden Graben alles im Fluss – in der Hoffnung, dass der alte Heraklit mir diesen holprigen Kalauer nachsieht.
- (1986) Aus dem Urwald wurde eine ansehnliche Parzelle.
- (1986) Farbenpracht blendete im Sommer das Auge.
- (1986) Die Herbstzeit in kräftigen Brauntönen.
- (1986) Als Toilette diente ein weißer Blechschuppen hinterm Haus.
- (1987) Als die Winter im norddeutschen Tiefland noch schneereich waren.
- (1988) Bauer Kaemenas sabbernde Kühe waren immer einen Hingucker wert.
Was der Garten einen lehrte
Wenn es hieß, dass ich auf der Parzelle an einem Tag mehr lernen konnte als in sechs Monaten Grundschule, so war das durchaus ernst gemeint. Gut, beim Bremischen Schulsystem vielleicht nicht gerade der beste Vergleich. Und zum Lernen gehört ja auch immer die nötige Bereitschaft. Die mir damals im Schulalltag überwiegend fehlte. Im Garten war das anders, da stimmte die Atmosphäre. Beobachten, ohne zu bewerten. Darüberhinaus gab es viele unbezahlbare Momente, z. B. wenn einen die Kuh überglücklich ansabbert, weil man mit dem Eimer voller Äpfel am Zaun steht. Der Garten prägte und veränderte einen. Vielleicht lag es daran, dass man ganze Tage an der frischen Luft verbrachte und Freiheit nicht nur ein abstrakter Begriff war? Oder weil hier die übliche Belästigung durch Schlagzeilen und Marktschreierei kaum hineindringen konnte? Was immer es war, es öffnete einen die Augen für die leisen Dinge. Für den Kreislauf der Natur.
Und führte auch dazu, dass man die vier Jahreszeiten viel intensiver wahrnimmt. Wenn im Herbst kühler Nebel aus den Gräsern aufstieg und sich mit erdigen Gerüchen vermengte, oder einen im Sommer das Konzert der Vögel und Insekten begleitete, war man froh, sein Leben nicht nur in der Stadt zu verbringen. Und wenn man bei Wind und Wetter unterwegs war, lernte man auch, um gewisse Zivilisationssünden wie „dem Schirm“ prinzipiell einen Bogen zu machen. Schließlich ist Humor der Regenschirm der Weisen. Das stammt zwar von Kästner, könnte aber auch von mir sein. So könnte ich die Tage an einer Hand abzählen, wo ich so ein albernes Ding in der Hand hielt. Regen ist für mich nichts anderes als flüssiger Sonnenschein, der vom Himmel fällt. Und das sogar umsonst. Und noch lange kein Grund, in kollektive Depression zu verfallen, wenn sich eine dunkle Wolke über einen wohlgesonnen entleert.
Mit elf Jahren hielt die Parzelle die nächste Erfahrung für mich bereit. Da wir dort auch übernachteten, konnte ich mich von Freitag bis Sonntag nicht mit Computerspielen zerstreuen. Was wie ein Witz klingt, war schlicht eine Herausforderung. Unter der Woche war ich ja daran gewöhnt, nach Unterrichtsschluss meinen Heimcomputer zum Glühen zu bringen. Und auch wenn es mir jeden Freitag auf der Zunge lag, vermied ich die Frage, ob man den C64 nicht einfach mal mit zur Parzelle schleppen könnte. Die schroffe Antwort konnte ich mir selber geben. So lernte ich zumindest eine der wichtigeren Lektionen, die man selten in der Schule vermittelt bekommt – sofern der Lehrer nicht gerade Daoist ist. Nämlich die heilsame Wirkung, wenn man die Balance zweier gegensätzlicher Zustände hält. Das ist ähnlich wie mit Pfarrer Kneipps Wechselduschen. Oder wenn man nach langer Abstinenz ein Bier trinkt. Ähnlich beschwingt wunderte ich mich damals, was zweieinhalb Tage Computerpause so alles bewirken können.
Und wie alles ein Ende hat, waren ab 1993 auch die letzten Monate unseres Parzellendaseins angebrochen. Mit 17 Jahren war die Gartenwelt für mich auch nicht mehr so cool wie früher. Den Samstagabend verbrachte ich da lieber in einer der Großraumdiskos im Bremer Umland. In aus heutiger Sicht lauten, schlecht belüfteten und nach Parfüm und Nebelfluid miefenden Orten, die so gut wie nichts mehr mit der Natürlichkeit gemeinsam hatten, die man im Kleingartengebiet fand. Außer dass man auch dort von der einen oder anderen Kuh mal angesabbert wurde. 1994 wurde die Parzelle dann aufgegeben. Als hätten meine Eltern eine Vorahnung gehabt, was in den nächsten Jahren folgen würde. Es war ja schon länger offenes Gerücht, dass die Universität ausgeweitet wird und unser Kleingartengebiet als perfekter Ort für Neubauten auserkoren war. Das wurde vier jahre später auch Realität. Besonders bitter für die restlichen sieben Bewohner der sog. „Kaisenhäuser“, die seit den Fünfzigern dort wohnten und im hohen Alter noch umgesiedelt werden mussten.
- (1990) Zur WM wurde die Deutschlandfahne gehisst.
- (1991) Die nächsten Anbauten mit Küche und Toilette kamen hinzu.
- (1991) Unbezahlbares Idyll. Auch nicht mit Mastercard.
- (1991) Die seitliche Eingangstür wurde später nach vorn verlegt.
- (1992) Die Entenfamilie kam oft zu Besuch.
- (1992) Die Grillecke hinterm Haus war die letzte der vielen Erweiterungen.
Technologieparkerweiterung – und vorbei der Traum vom ländlichen Idyll
So bekamen 1998 fast alle Kleingartenbesitzer der „Guten Ernte“ ihre Kündigung. Wenig später wurden die Gärten geräumt und auf dem 15 Hektar großen Areal 173 Parzellen samt Kuhweide innerhalb weniger Wochen in eine Mondlandschaft verwandelt. Wo sich dann der Technologiepark innerhalb von fünf Jahren ausbreiten sollte. So zumindest der Plan. So habe ich es mir nicht nehmen lassen, bei meinem Heimatbesuch im Mai vorbeizufahren und zu schauen, was aus dem Idyll von einst geworden ist. Es sind seit der Räumung ja fast 25 Jahre vergangen. Und über 30 Jahre, wo die goldene Zeit unseres Parzellendaseins sich dem Ende näherte. Also rauf aufs Rad und zurück in die Vergangenheit. Fährt man durch den Bürgerpark und Stadtwald zur Munte, biegt dann in den Kleingartenverein „Harmonie“ ein, schaut überraschenderweise alles noch wie damals aus. Die vertrauten Gerüche. Und auch die Ruhe, die hier noch in der Luft liegt.
Und dann die Ernüchterung, wenn hinter wildgewachsenen Sträuchern anstelle des „Gerhard-Lange-Wegs“ nun der Technologiepark zum Vorschein kommt. Wobei mit „Park“ sicherlich die leeren Parkplätze gemeint sind. Davon gibt es offensichtlich mehr als genug. Die zugehörigen Gebäude fehlen an vielen Stellen noch. Dem bremischen Bautempo gemäß, wurden insgesamt über ein halbes Dutzend Bürogebäude errichtet. Überwiegend seelenlose Zweckarchitektur, eines immerhin mit ansprechender Klinkerfassade. Der Rest der riesigen Fläche ist auch heute noch unbebaut. Schaut aus wie unsere Parzelle im Urzustand 1982. Und als Ironie des Zeitlichen stehen nun genau dort, wo unsere große Pappel einst stand, hinter Bauzäunen ein paar Betonmischer. Hoffentlich kommt niemand auf die Idee, sich da wieder einen Bunker anzulegen.

Die südliche Erweiterung des Bremer Technologieparks auf dem Gelände des alten Kleingartenvereins „Gute Ernte“. Nach über 20 Jahren hat sich hier bis auf ein paar Straßen und einer Handvoll Bürogebäude nicht wirklich viel getan. Aber selbst wenn nun alles bebaut wäre, wäre das kein Trost für alle, die damals ihren Garten hier aufgeben mussten. Die letzten wenigen Parzellen der „Gute Ernte“ erkennt man am Schild eines Blumenkübels. Bilder vom Mai 2022.
Fazit – der Garten als florierendes Gegengewicht zur Künstlichkeit
Auch wenn Moritz Schreber das Aufblühen der „Schrebergärten“ selber nicht mehr erleben konnte, so hätte er gewiss zugestimmt, dass eine eigene Parzelle nicht nur die Begleiterscheinungen der Industrialisierung, sondern auch die unseres digitalen Zeitalters lindern kann. Die Vorzüge eines Gartens liegen ja auf der Hand. Abschalten, für ein paar Stunden die Wirren des Joballtags vergessen und das Gemüse mit eigenen Händen anbauen. Bei den aktuellen Preisen bestimmt nicht die schlechteste Idee. So könnte man als Resümee diese Orte als Gegengewicht zu dem bezeichnen, was gerne als Fortschritt verkauft wird. In einer Zeit, wo die wahre Inflation eher das Artifizielle ist. Geht man aufmerksam durchs Leben, spürt man ja schnell, wie wenig Natürlichkeit in den Dingen um einen herum noch vorhanden ist. Und damit ist mehr als die bereits geschälte und eingeschweißte Banane im Supermarkt gemeint.
Die ganze Bandbreite an suggerierender Kommunikation, synthetischen Gerüchen, chemisch angereicherten Textilien, Lebensmittelimitaten, mit Werbung kontaminierter Information. Und nicht zu vergessen die aufgesetzten Verhaltensmuster, die das Digitalzeitalter wie Schimmelpilze züchtet. Da lohnt es sich auszusteigen – auch wenn man keinen Garten (mehr) hat und es nur für ein paar Augenblicke ist. Passiert mir recht oft. Besonders, wenn ich verloren in irgendwelchen Meetings sitze, wo viel geredet und wenig gesagt wird. Man kostbare Zeit künstlich aufbläht und bestenfalls Schlagworte hinten raus kommen. Als Notbehelf bleibt dann nur, aufmerksam aus der Wäsche zu schauen. Obwohl der Geist ganz woanders unterwegs ist. Vielleicht in der Vergangenheit und den goldenen Jahren auf der Parzelle? Irgendwann erwache ich wieder aus diesem Zustand. Und bringe als Souvenir die wirklich interessante Frage in diesem Zusammenhang mit: „Was hat man davon, fließend Wortphrasen zu sprechen, wenn man noch nie von einer Kuh angesabbert wurde?“



























Schreibe einen Kommentar