Neue Marotten fallen einem meist spät auf. Und dann wundert man sich, wie sich das eigene Verhalten in den letzten Jahren schleichend verändern konnte, ohne dass man es selber richtig mitbekam. So stolperte ich vor kurzem darüber, dass ich schon lange kein Bargeld mehr nutze. Oder besser gesagt, fast kein Bargeld. Der Euro für den Einkaufswagen ist das letzte Relikt in meinem Portemonnaie, das von längst vergangener Zeit zeugt. Wenn möglich, zahle ich mit Kreditkarte. Ist halt praktisch und bläht die Geldbörse nicht so auf wie Bargeld. Außerdem weiß man bei Scheinen nie, welcher Schmierlappen das Ding vorher in den Händen hielt. Da stellt sich provokant die Frage, ob eine klassische Geldbörse überhaupt noch sinnvoll ist?

1000 DM Schein (1964) – Abbildung von Johannes Scheyring (†1516)
Meine Geldbörse hat sich in den letzten Jahren immer mehr entschlankt. Früher war sie dick mit Klimpergeld ausgebeult, das dann irgendwann notgedrungen im Sparschwein landete. Und wenn größere Anschaffungen angesagt waren, dann stand ich an der Kasse und sortierte wie auf dem Basar ein Bündel Scheine zusammen. Dieser Akt ist schon lange passé, fast alle Transaktionen laufen inzwischen über die Kreditkarte. Selbst in Discountern kann man heute kontaktlos zahlen. Ein kurzes Ranhalten ans Lesegerät und schon ist die Schuld getilgt. Praktisch, kein lästiges Unterschreiben, PIN eintippen oder falsches Reinstecken der Karte mehr. Soll angeblich sogar sicher sein. Geht wahrscheinlich so lange gut, bis der erste Halunke einen in der S-Bahn unbemerkt ein Lesegerät an die Hinterbacke hält. Aber dafür gibt es ja NFC-Schutzhüllen (Near Field Communication), die genau das verhindern sollen.
Dennoch zahlt man in Deutschland im Jahr 2018 weiterhin überwiegend mit Bargeld. Kontaktloses Bezahlen, sei es via Smartphone oder NFC-Karten, kommt derzeit noch nicht einmal auf fünf Prozent Anteil. Bares ist nach wie vor Wahres. Berücksichtigt man allerdings, dass vor gut zwanzig Jahren fast der gesamte Zahlungsverkehr im Einzelhandel noch über handfestes Geld abgelaufen ist, dann muss man kein Hellseher sein, um zu prognostizieren, dass der Begriff „Bargeld“ bald zum Archaismus wird. Wie schon jetzt in Schweden, wo sich immer mehr Geschäfte weigern, diese verruchten Geldscheine und Münzen anzunehmen.
Blick zurück: Faszination Papiergeld
Papiergeld existiert in unserem Land bereits seit dem Absolutismus. Im frühen 18. Jahrhundert wurden in Köln die ersten als „Bancozettel“ getauften Banknoten im Umlauf gebracht. Bis zur Deutschen Mark war es da noch ein wenig hin. Diese erblickte nach dem Zweiten Weltkrieg erstmalig das Licht der Welt, wurde noch in den USA gedruckt und kam in einer Nacht-und-Nebel-Aktion (1948) mit dem Schiff in Bremerhaven an. Und es wunderte kaum, dass die Scheine eine frappierende Ähnlichkeit zum US-Dollar aufwiesen. Immerhin orientierte man sich bei der Bebilderung an europäischer Kultur – „Miss Liberty“ und „Uncle Sam“ blieben glücklicherweise erspart.

Zwanzig Deutsche „Dollar“ (1948)
Mein persönlicher Kontakt mit der Deutschen Mark begann mit der dritten Serie, die ab 1961 in Umlauf kam. Die älteren Scheine kannte ich nur vom Hörensagen der Großeltern. Und schon in früher Kindheit faszinierte mich dieses ehrwürdig aussehende Papier, um das die Erwachsenen immer so ein Geschiss machten. Es fühlte sich ganz anders als herkömmliches Papier an, und die Abbildungen hatten etwas Archaisches an sich, das ich als Kind noch gar nicht einordnen konnte. Und ich fragte mich, wer diese trüb aus der Wäsche schauenden und seltsam frisierten Personen waren, und warum man gerade sie auf Scheine gedruckt hat.
Dabei hatte sich die Bundesbank bei der Gestaltung der Scheine einiges gedacht. Bei den Kopfbildnissen orientierte man sich an kulturhistorischen Gemälden der Renaissance. Jene Kulturepoche, die so bedeutungsvoll und wichtig war. Die Ruhe nach dem Sturm, ein Wiederentdecken der glanzvollen Leistungen der Antike nach einem Zwischenzeitalter des Verfalls. Diese „Wiedergeburt“ alter Werte passte gut in eine Zeit, die nach zwei Weltkriegen arg gebeutelt war. Daneben hatten die Werke von Dürer, Cranach und Konsorten auch einen praktischen Nutzen. Sie waren durch ihre Komplexität sehr schwer nachzuahmen. Gut für die Bundesbank, das Zeitalter der Farbkopierer war noch nicht angebrochen. Blöd für Fälscher, sie mussten ihre Blüten weiterhin in mühevoller Kleinarbeit fabrizieren.
- 10 Deutsche Mark (1963)
- 10 Deutsche Mark (1963)
- 20 Deutsche Mark (1961)
- 20 Deutsche Mark (1961)
- 50 Deutsche Mark (1962)
- 50 Deutsche Mark (1962)
- 100 Deutsche Mark (1962)
- 100 Deutsche Mark (1962)
- 500 Deutsche Mark (1965)
- 500 Deutsche Mark (1965)
- 1000 Deutsche Mark (1964)
- 1000 Deutsche Mark (1964)
Neben den Porträts auf der Vorderseite belegte man die Rückseite mit Kulturgut und teutonischer Symbolik. Die Gorch Fock fand sich dort wieder, ebenso der Limburger Dom und der Bundesadler. Schaute man genau hin, so entdeckte man auf der Rückseite eines jeden Scheins auch noch das Kleingedruckte: „Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.“ Das ist quasi so, als würde man heute auf Farbsprühdosen vorsorglich einen Hinweis zur Strafbarkeit wegen Sachbeschädigung platzieren.
Da in Kinderjahren zwangsläufig nur das Taschengeld als Erwerbsquelle existierte, beschränkte sich mein Kontakt mit der D-Mark meist auf das Münzgeld. Zur damaligen Zeit hatte man für einen „Groschen“ (10-Pfennigstück) auch noch einen Verwendungszweck, und wenn es nur lose Bonbons beim Krämer waren. Heute bleibt bei den Eurocent-Münzen nur das Sparschwein oder die Möglichkeit, sie dem nächstbesten Flaschensammler in die Hand zu drücken.
Zu den Pfennigen gesellte sich in meiner Minibörse das Markstück mit den eingravierten Arabesken am Rand. Dann der „Zweier“ als Münze mit verschiedenen Bundeskanzlern und Bundespräsidenten drauf. Und zuletzt der schwergewichtige „Heiermann“ (5-Markstück). Selten kam mal ein Zehner dazu, zu Weihnachten mal ein Fünfziger. Wollte ich die richtig dicken Brocken kurz in den Händen halten, musste ich versprechen, ja nichts zu zerknittern oder daran zu reißen. Geld war Erwachsenen heilig. Den zotteligen Typen auf dem alten Tausender hielt ich nur ein einziges Mal in den Händen. Und fragte mich, wie so ein Lappen von 180 × 90 mm überhaupt in eine normale Geldbörse passt.
Mit der Wiedervereinigung kam das Bonbongeld
Der Zahn der Zeit hatte an den alten Scheinen deutlich genagt. Besonders der technische Fortschritt hat es Fälschern viel leichter gemacht, und so wurde Ende der Achtziger im großen Stil wieder D-Mark fabriziert. Dummerweise nicht in Frankfurt, sondern in osteuropäischen Hinterhof-Druckereien. Und so entschloss man sich, neues Bargeld mit verbesserter Sicherheits-Rezeptur ab Oktober 1990 in Umlauf zu bringen. Neben Glanzstreifen und Kinegrammen (je nach Winkel und Lichteinfall unterschiedliche Bildwirkung) kamen auch spezielle Muster zum Einsatz, die auf Farbkopierern den Scan- bzw. Kopiervorgang verhindern sollten.
Was die Wahl der Abbildungen betraf, so blieb man sich treu. Einflussreiche Figuren der deutschen Geschichte aus angesehenen Fachgebieten zierten die Vorderseite. Neu hingegen war, dass die Rückseite nun im direkten Zusammenhang mit der abgebildeten Person stand. So zierte z. B. das von Gauß erfundene Heliotrop die Rückseite des neuen Zehners. Und die Gebrüder Grimm auf dem Tausender hatten auf der Rückseite erwartungsgemäß eine Abbildung ihres Deutschen Wörterbuchs.
Auffallend war die hohe Farbsättigung, die den Scheinen unfreiwillig einen infantilen Charakter gab und mehr an Spielgeld für Kinder erinnerte. Im Volksmund sprach sich schnell das neue Bonbongeld herum, dem zunächst jeder skeptisch gegenüberstand. Zumindest hier im Westen – die Ossis waren wahrscheinlich froh, endlich keinen Karl Marx und Friedrich Engels beim Bezahlen mehr anblicken zu müssen. Aus heutiger Sicht frage ich mich, was damals der konkrete Anlass für diese farbliche Versalzung war? Hätte man nur etwas weniger Sättigung verwendet, wären die Scheine wie ihre Vorgänger viel würdevoller und abgerundeter dahergekommen.
- 10 Deutsche Mark (1991)
- 10 Deutsche Mark (1991)
- 20 Deutsche Mark (1992)
- 20 Deutsche Mark (1992)
- 50 Deutsche Mark (1991)
- 50 Deutsche Mark (1991)
- 100 Deutsche Mark (1990)
- 100 Deutsche Mark (1990)
- 500 Deutsche Mark (1992)
- 500 Deutsche Mark (1992)
- 1000 Deutsche Mark (1992)
- 1000 Deutsche Mark (1992)
Fazit: Ohne Moos (auch künftig) nix los
Und so verging die Zeit und damit auch die D-Mark. Der Euro kam am 1. Januar 2002 und viele sehnten sich nach der Mark zurück. Kein Wunder, hatte sich die Zahl auf dem Kontoauszug über Nacht um die Hälfte reduziert. Hinzu kam, dass viele Unternehmen die Euroumstellung als attraktive Gelegenheit sahen, um still und verstohlen die Preise anzuheben. Und wenn dann auch noch der Dönermann den alten Preis gleich ganz unverändert ließ und nur das Währungssymbol tauschte, dann wundert es nicht, dass viele den Euro als Teuro einstuften. Dafür konnte man bei „Wer wird Millionär“ ab 2002 nun eine Million Euro anstelle D-Mark gewinnen. Nicht weil RTL so großzügig war. Man scheute sich nur, den Sendungstitel in „Wer wird halber Millionär“ umzubenennen.
Im Grunde spielen wir noch immer dasselbe Spiel wie unsere Altvorderen. Geld regiert die Welt, und hat man nichts, dann ist man nichts. Der einzige Unterschied ist, dass die mit Scheinen gefüllten Kopfkissen der Ahnen heute obskure Konten bei irgendwelchen Banken sind. Geldvermögen ist nicht mehr greifbar, sondern nur eine Ziffer, die man im Online-Bankkonto einsehen kann. Dagobert Duck hätte als Trockenschwimmer wenig Freude an unserer Zeit.
Da stellt sich nun wirklich die Frage, wozu man Bargeld überhaupt noch braucht? Statt klassischer Lohntüte bekommt man die Kohle aufs Konto überwiesen, rennt dann zum Geldautomaten, um die gezogene Asche wieder für alltägliche Dinge einzutauschen. Diesen Schritt kann man sich auch schenken. Alle anderen Ausgaben wie Miete, Energiekosten oder Telefonrechnung laufen ja auch nicht mehr in bar ab.
So mag die gute Knete vielleicht in zwanzig Jahren wirklich ausgestorben sein. Das wäre aber auch irgendwie schade, fällt damit eine erprobte Virenschleuder weg, die unser Immunsystem seit jeher auf Trab hält. Bei Geldscheinen weiß man schließlich nie, welcher Rotzmichel das Ding vor einen in der Hand gehalten hat. Auch ginge ohne Bargeld ein Stück Menschheitsgeschichte verloren, das die Chinesen bereits im 11. Jahrhundert kultiviert hatten.




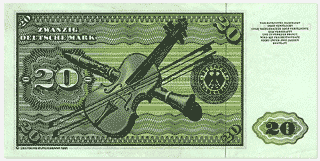



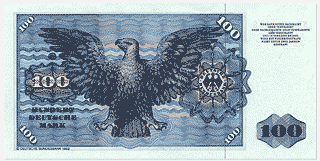

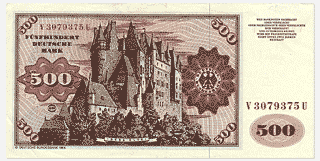



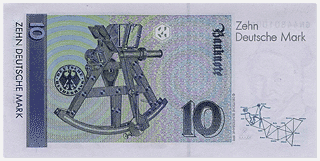



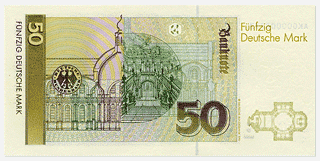
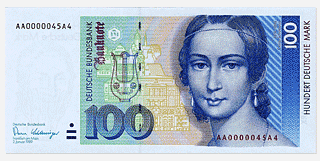
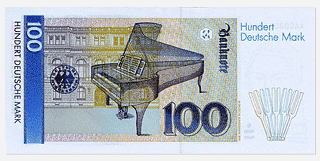



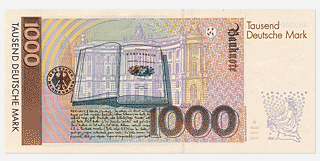








Schreibe einen Kommentar